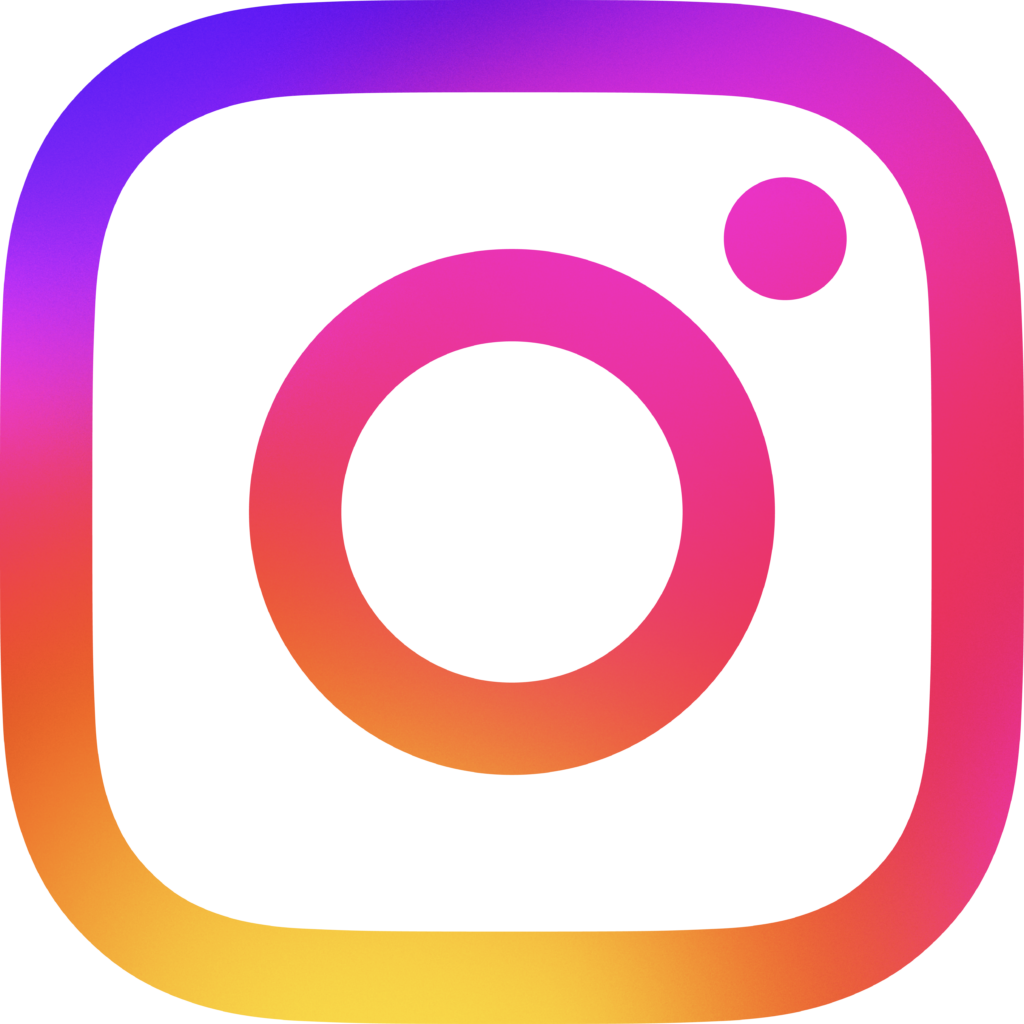Am 25. März 2025 wurde die neue WHO Guidance on Mental Health Policy and Strategic Action Plans mittels einer Onlineveranstaltung weltweit vorgestellt. Die Transparente Psychiatrie war live dabei und hat die wichtigsten Inhalte zusammengefasst.
Tedros Adhanom Ghebreyesus Generaldirektor der WHO, eröffnete das Event mit einer klaren Botschaft: „Es gibt keine Gesundheit ohne mentale Gesundheit.“ Sie betonte, dass viele Länder noch immer veraltete, unzureichend finanzierte und nicht evidenzbasierte psychiatrische Gesundheitssysteme aufweisen. Die neue WHO-Leitlinie soll Ländern helfen, gerechte, wirksame und nachhaltige psychiatrische Gesundheitsdienste zu etablieren, die auf den Grundsätzen der Menschenrechte und des well-beeing beruhen.
Erfahrungen aus der Praxis
Ein besonders bewegender Moment war der Beitrag von Jarrod Clyne, stellvertretender Direktor der International Disability Alliance und selbst Betroffener. Er berichtete von seinen eigenen Erfahrungen mit Zwangsmaßnahmen in einer psychiatrischen Einrichtung vor über 20 Jahren und betonte, dass physische als auch chemische Zwangsmaßnahmen in der psychiatrischen Versorgung nicht hilfreich sind, da sie Recovery verhindern und dauerhafte Schäden verursachen. Jarrod Clyne lobte die WHO-Leitlinie als „Beginn der moralischen Heilung“, die sowohl die Vergangenheit anerkenne als auch Hoffnung für die Zukunft biete.
Er hob die Bedeutung der Beteiligung von Menschen mit psychosozialen Behinderungen und Überlebenden hervor, um die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen und sicherzustellen, dass zukünftige psychiatrische Versorgungssysteme auf den tatsächlichen Bedürfnissen der Betroffenen basieren.
Schlüsselthemen der WHO-Leitlinie
Die WHO-Leitlinie bietet umfassende Strategien für eine Reihe von entscheidenden Themen.
- Bekämpfung von Stigma und Diskriminierung: Zielgerichtete Interventionen zur Bekämpfung von Stigma, unterstützt von Betroffenen aus Erfahrung.
- Deinstitutionalisierung: Ein klarer Plan für die Umstellung auf eine gemeindenahe Versorgung welche integrative und unterstützende Dienste bereitstellt.
- Personenzentrierte und auf Rechte basierte Versorgung: Förderung von umfassenden, ganzheitlichen Modellen der Gesundheitsversorgung, die nicht nur klinische Bedürfnisse, sondern auch soziale Determinanten wie Wohnen und Arbeit einbeziehen.
- Abschaffung von Zwang und Missbrauch: Einführung konkreter Schritte zur Eliminierung von Zwangsmaßnahmen und zum Schutz der Entscheidungsfreiheit der Betroffenen.
Hierzu gliedert sich die Guideline in folgende Module:
Modul 1: Einführung, Zielsetzung und Anwendung der Leitlinie
Modul 2: Zentrale Reformbereiche, Richtlinien, Strategien und Maßnahmen für die Entwicklung von psychiatrischen Versorgungs- und Aktionsplänen
Modul 3: Prozess zur Entwicklung, Umsetzung und Evaluation psychiatrischer Versorgungs- und Aktionspläne
Modul 4: Länderspezifische Fallbeispiele
Modul 5: Umfassendes Verzeichnis relevanter Politikbereiche, Richtlinien, Strategien und Maßnahmen
Zukünftige Anwendungen und Aufruf zum Handeln
Michelle Funk von der WHO erklärte, dass die neue Leitlinie für politische Entscheidungsträger*innen bis hin zu Fachpersonal im Gesundheitswesen und Menschen mit eigener Erfahrung von Nutzen ist. Die Leitlinie bietet einen systematischen Rahmen zur Überprüfung und Neugestaltung nationaler Gesundheitssysteme und fordert dazu auf, internationale Menschenrechtsstandards bis 2030 zu erfüllen.
Die Leitlinie ermutigt dazu, die Gesundheitssysteme in einer Weise zu reformieren, die sowohl evidenzbasiert als auch rechtskonform ist. Sie ist ein praktisches Werkzeug, das nicht nur als Dokument, sondern als Appell zur Transformation verstanden werden sollte.
Die gemeinsame Vision ist eine Welt, in der psychische Gesundheit integraler Bestandteil der primären Gesundheitsversorgung ist und in der Dienstleistungen zugänglich, respektvoll und empowernd gestaltet sind. Die Planung im Bereich der psychischen Gesundheit sollte zudem soziale und strukturelle Faktoren wie Armut, Wohnen, Bildung und Beschäftigung berücksichtigen sowie die negativen Auswirkungen von Stigmatisierung, Diskriminierung und anderen systemischen Barrieren mit einbeziehen. Die Auseinandersetzung mit diesen miteinander verknüpften Herausforderungen ist entscheidend für ganzheitliche und nachhaltige Ergebnisse.
Die Veröffentlichung der WHO-Leitlinie Guidance on mental health policy and strategic action plans ist ein historischer Schritt hin zu einer gerechteren und inklusiveren Gesundheitsversorgung.

Nachfolgend zwei Ausschnitte von der Guideline aus Modul 4 bezüglich Psychopharmaka und Deinstitutionalisierung:
Richtlinie 4.3: Psychotrope Medikation
Strategie 4.3.1
Leitlinien für die sichere Verordnung, Anwendung und Beendigung der Behandlung mit psychotropen Medikamenten implementieren.
Ziel(e):
- Schulungen zur sicheren Verordnung, Anwendung und Beendigung der Behandlung mit psychotropen Medikamenten für Mitarbeitende aller verschreibenden Einrichtungen.
- Bereitstellung von Informationsblättern für alle Nutzer*innen von Versorgungsangeboten zu den potenziellen Vorteilen und Nebenwirkungen der Medikamente.
Maßnahmen:
- Entwicklung und Umsetzung von Schulungsprogrammen zur sicheren Verordnung, Anwendung und Beendigung der Behandlung mit psychotropen Medikamenten, einschließlich des Umgangs mit Nebenwirkungen und Entzugserscheinungen.
- Verknüpfung dieser Schulungsprogramme mit Berufsverbänden und Akkreditierungsprozessen, um eine fachliche Integration zu gewährleisten.
- Erstellung umfassender und leicht zugänglicher Informationsmaterialien zur Aufklärung von Nutzer*innen, deren Angehörigen und Betreuungspersonen über den Einsatz psychotroper Medikamente, einschließlich deren Nutzen, möglicher Nebenwirkungen und Aspekte des Absetzens.
Richtlinie 2.4: Deinstitutionalisierung
Strategie 2.4.1
Einrichtung eines Managementkomitees für Deinstitutionalisierung in jeder Institution zur Entwicklung und Umsetzung des Deinstitutionalisierungsprozesses.
Ziel(e):
- Ausarbeitung eines detaillierten Plans und Abschluss der Schulungen innerhalb des ersten Jahres.
Maßnahmen:
- Gründung eines Managementkomitees für Deinstitutionalisierung in jeder Institution zur Steuerung und Umsetzung des Prozesses.
- Schulung der Mitarbeitenden in Einrichtungen zu menschenrechtsbasierten und recovery-orientierten Ansätzen in der psychiatrischen Versorgung.
- Entwicklung und Umsetzung eines spezifischen Deinstitutionalisierungsplans für jede Institution.
- Identifikation von gemeindenahen psychiatrischen Versorgungsangeboten, in denen Mitarbeitende im Rahmen der Deinstitutionalisierung eingesetzt werden können.
- Schulung des Personals zur Erstellung individueller Übergangspläne für Menschen, die aus Institutionen entlassen werden.
Wie sieht die aktuelle Situation aus
Im Bereich der Medikamentenaufklärung sowie der Einleitung von Deinstitutionalisierungsprozessen besteht eindeutig ein erheblicher Verbesserungsbedarf. Das Credo „Wir benötigen mehr stationäre Versorgungsangebote“ sollte durch den Ausbau gemeindenaher Versorgungsstrukturen wie Soteria-Einrichtungen, Crisis Units und Weglaufhäuser ersetzt werden.
Die Transparente Psychiatrie wird sich auch weiterhin engagiert dafür einsetzen, die psychiatrische Versorgungslandschaft dazu zu ermutigen, menschenrechtsbasierte Ansätze zu etablieren.
Anbei der Link zur Guideline