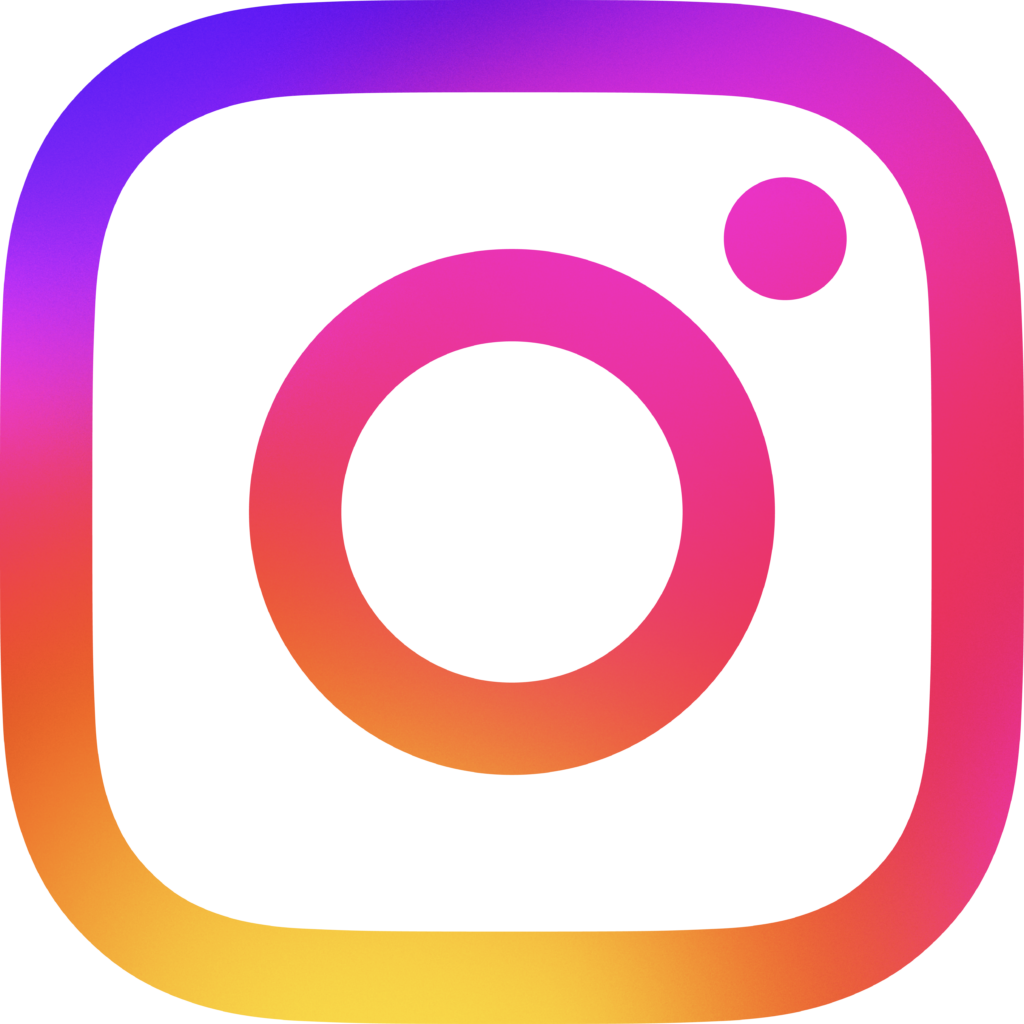Wir leben in einer Ära globaler Umbrüche. Politische, soziale und wirtschaftliche Strukturen verändern sich rasant – oft begleitet von Unsicherheiten und Spannungen. Gerade in solchen Zeiten ist es essenziell, demokratische Strukturen zu bewahren und zu stärken. Sie sind der Schlüssel, um eine gerechte, menschenrechtsbasierte Zukunft zu gestalten – nicht nur im gesellschaftlichen, sondern auch im institutionellen Kontext, wie etwa in der Psychiatrie.
Michel Foucault hat in seinen Werken eindringlich aufgezeigt, dass die Psychiatrie ein Ort ist, an dem Machtstrukturen besonders sichtbar und zugleich anfällig für Missbrauch sind. Hier treffen Expert*innenwissen, institutionelle Kontrolle und die Definitionsmacht über „Norm“ und „Abweichung“ direkt aufeinander. In demokratischen Gesellschaften befinden wir uns aktuell in einer wichtigen Phase der Aufarbeitung solcher Machtmissbräuche. Es gibt zunehmend Diskussionen über Zwangsmaßnahmen, Stigmatisierung und den Umgang mit Autonomie in psychiatrischen Einrichtungen. In autoritären oder undemokratischen Kontexten hingegen wäre die Gefahr eines Machtmissbrauchs weitaus größer. Dort könnten diese Strukturen ungehindert bestehen oder gar verschärft werden. Stigmatisierung oder die vollständige Unterdrückung von Selbstbestimmung. Die demokratische Grundlage bietet daher nicht nur Schutz, sondern auch die Möglichkeit, den notwendigen Wandel hin zu einer menschenrechtsbasierten Psychiatrie aktiv voranzutreiben.
Ein entscheidender Faktor für den Schutz von Menschenrechten in der Psychiatrie ist die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), die grundlegende Rechte für Menschen mit Behinderungen garantiert und dabei auch die Rechte von Menschen mit psychischen Erkrankungen berücksichtigt. Diese internationale Vereinbarung bietet einen wichtigen Rahmen, um menschenwürdige, selbstbestimmte Lebensbedingungen zu fördern und die Praktiken in psychiatrischen Einrichtungen zu reformieren. In Übereinstimmung mit der UN-BRK ist es wichtig, dass demokratische Gesellschaften den Weg zu einer psychischen Gesundheitsversorgung einschlagen, die nicht auf Zwang basiert, sondern auf Respekt und Autonomie. Doch gerade in Zeiten politischer Umwälzungen muss die UN-BRK auch vor Demontageversuchen geschützt werden. Ihre Prinzipien dürfen nicht aufgeweicht oder verwässert werden, da sie ein unverzichtbarer Schutzschild für die Rechte von Menschen mit psychischen Erkrankungen und Behinderungen sind.
Warum sind demokratische Strukturen in diesem Kontext so entscheidend? Weil sie Raum für Mitbestimmung, Kritik und Veränderung schaffen. Nur in einer demokratischen Gesellschaft ist es möglich, veraltete und menschenrechtswidrige Praktiken zu hinterfragen und Transformationen einzuleiten. In der Psychiatrie bedeutet das konkret: den Weg hin zu einer menschenrechtsbasierten Versorgung einzuschlagen, die Zwang reduziert und die Würde sowie die Autonomie der Betroffenen ins Zentrum stellt.
Demokratie bedeutet, dass alle Stimmen gehört werden – insbesondere jene, die häufig marginalisiert oder übergangen werden. In psychiatrischen Einrichtungen sind das oft Patient*innen, Angehörige und auch Mitarbeitende, die Veränderungen fordern. Demokratische Werte wie Partizipation, Transparenz und Inklusion bilden die Grundlage für Dialog und Innovation.
In Zeiten politischen Wandels dürfen wir diese Grundwerte nicht preisgeben. Vielmehr sollten wir sie als Kompass nutzen, um Strukturen neu zu denken – und zwar so, dass sie die Rechte und Bedürfnisse aller Menschen respektieren. Nur so können wir sicherstellen, dass auch sensible Bereiche wie die Psychiatrie zu einem Ort von Recovery und nicht der Ausgrenzung werden.
Lasst uns Demokratie nicht als Selbstverständlichkeit betrachten, sondern als Werkzeug, das es zu schützen und aktiv zu nutzen gilt – für eine gerechtere Welt, und für eine menschenrechtsbasierte Psychiatrie.